Innere Antreiber im New-Work-Kontext
In den 1970er-Jahren prägte das Modell der Transaktionsanalyse erstmals eine Sprache für den inneren Druck, den viele Menschen verspüren: "Sei perfekt!", „Sei stark!“, „Streng dich an!“, „Mach es allen recht!“, "Sei schnell!". Solche Botschaften waren Antworten auf das Arbeitsklima einer Industriegesellschaft, in der Disziplin, Anpassung und Pflichtbewusstsein gefragt waren. Sie halfen, Erwartungen zu erfüllen – und zeigten zugleich, wie leicht aus Orientierung Zwang werden kann.
Heute hat sich das Bild verschoben. Statt Anpassung zählen Originalität, Sinnsuche und Selbstentfaltung. Die alten Antreiber allein erklären nicht mehr, was uns im Arbeitsleben treibt. Neue Stimmen sind hinzugekommen: „Sei besonders“, „Sei effizient“, „Sei agil“, „Sei positiv“ und „Sei sinnvoll“. Sie treten nicht als strenge Befehle auf, sondern als freundliche Einladungen. Wer möchte das nicht – besonders sein, Sinn stiften, flexibel und voller Energie durchs Leben gehen?
Gerade darin liegt ihre Kraft – und ihre Tücke. Denn wo früher der Druck von außen spürbar war, wirken die neuen Antreiber subtil von innen. Sie fühlen sich an wie Freiheit, können aber unbemerkt zu einer Quelle ständiger Selbstoptimierung werden.
Nachfolgend werden die fünf New-Work-Antreiber vorgestellt: Welche Sehnsucht sie ansprechen, welche Stärke in ihnen liegt – und wo sie kippen können. Eine Einladung zur Selbstreflexion und zur Frage: Welche dieser Stimmen prägt mein Leben besonders stark?
- Sei besonders!SteckbriefImmer auf der Suche nach Anerkennung durch Originalität, liebt diese Person es, Ideen sichtbar zu machen und mit Storytelling zu glänzen. In einer Arbeitswelt, die Sichtbarkeit fast zur Pflicht erhebt, wird Resonanz zum Taktgeber: Applaus und Follower liefern kurze Kicks, doch im Hintergrund sitzt die Angst, im Mittelmaß zu verschwinden. Die Stärke liegt darin, andere zu inspirieren, Lern- und Netzwerkräume zu öffnen und Dynamik zu entfachen. Dabei rutscht Authentizität leicht in Inszenierung, wenn das Profil wichtiger wird als die Person selbst. Übersteuert kippt der Antreiber in Show-Sucht, Vergleichsschleifen und innere Leere – ein glänzendes Außen bei schwindendem Innen.
- Sei effizient!SteckbriefStändig auf der Suche nach dem kürzesten Weg und der besten Methode, liebt es dieser Antreiber, Abläufe zu optimieren, Routinen zu verfeinern und mit klarem Fokus Ergebnisse zu erzielen. Jeder Tag wird in Projekte, To-dos und Timeboxes gegossen – jede Minute soll Wirkung entfalten. Die Stärke liegt in Klarheit, Struktur und Umsetzungsstärke: nichts verpufft, alles zahlt auf ein Ziel ein. Doch die Effizienzlogik kennt kaum Grenzen. Übersteuert kippt sie in Rastlosigkeit, in das Gefühl, nie fertig zu sein, in eine Kultur, in der selbst Pausen zum Tool und Erholung zur Aufgabe wird. Zurück bleibt oft das stille Empfinden: Ich funktioniere – aber wann lebe ich?
- Sei agil!Immer auf der Suche nach Bewegung und Anpassung, liebt dieser Antreiber es, flexibel zu reagieren, neue Methoden auszuprobieren und Veränderungen als Chance zu begreifen. Agilität verspricht Freiheit, Tempo und Innovation – ständig bereit, die nächste Rolle einzunehmen, das nächste Projekt zu starten, das nächste Tool zu lernen. Die Stärke liegt im schnellen Denken, in der Offenheit für Neues und im Mut, Routinen aufzubrechen. Doch übersteuert kippt der Antrieb in Entwurzelung: Wenn kein Halt mehr bleibt, jeder Rahmen vorläufig wirkt und jede Sicherheit verschwindet, entsteht Erschöpfung. Dann wird Wandel zum Zwang, Flexibilität zur Überforderung – und zurück bleibt das stille Gefühl, nie ankommen zu dürfen.Steckbrief
- Sei positiv!SteckbriefImmer auf der Suche nach dem hellen Blickwinkel, liebt dieser Antreiber es, Chancen zu betonen, Lösungen hervorzuheben und mit Optimismus Stimmung zu machen. Positivität wirkt wie eine Eintrittskarte: Sie schafft Anschlussfähigkeit, beschleunigt Prozesse, erleichtert Zusammenarbeit. Die Stärke liegt in Zuversicht, Motivationskraft und der Fähigkeit, andere mitzureißen. Doch übersteuert kippt der Antrieb in Zwang: Skepsis oder Trauer werden ausgeblendet, Zweifel zur Schwäche erklärt, Gefühle auf ein „Alles wird gut“ reduziert. Zurück bleibt die innere Dissonanz – ein Lächeln, das mehr kostet als es trägt, und das stille Gefühl, nicht mehr sagen zu dürfen, wie es wirklich geht.
- Sei sinnvoll!SteckbriefImmer auf der Suche nach Bedeutung, liebt dieser Antreiber es, Arbeit mit einem größeren „Wozu“ zu verknüpfen und sich als Teil von etwas Bedeutsamem zu erleben. Sinn stiftet Motivation, gibt Energie und das Gefühl, gebraucht zu werden. Die Stärke liegt in Hingabe, Verantwortung und der Fähigkeit, Visionen in den Alltag zu tragen. Doch übersteuert kippt der Antrieb in Schuldgefühle: Wer keinen „Impact“ spürt, fühlt sich wertlos; jede Routinearbeit erscheint leer, jede Pause verdächtig. Dann wird Sinn zur Pflicht, Purpose zum Zwang – und das Leben wirkt wie ein Test, den man nur bestehen darf, wenn alles einen höheren Beitrag leistet.
Innere Antreiber im New Work Kontext - Steckbriefe
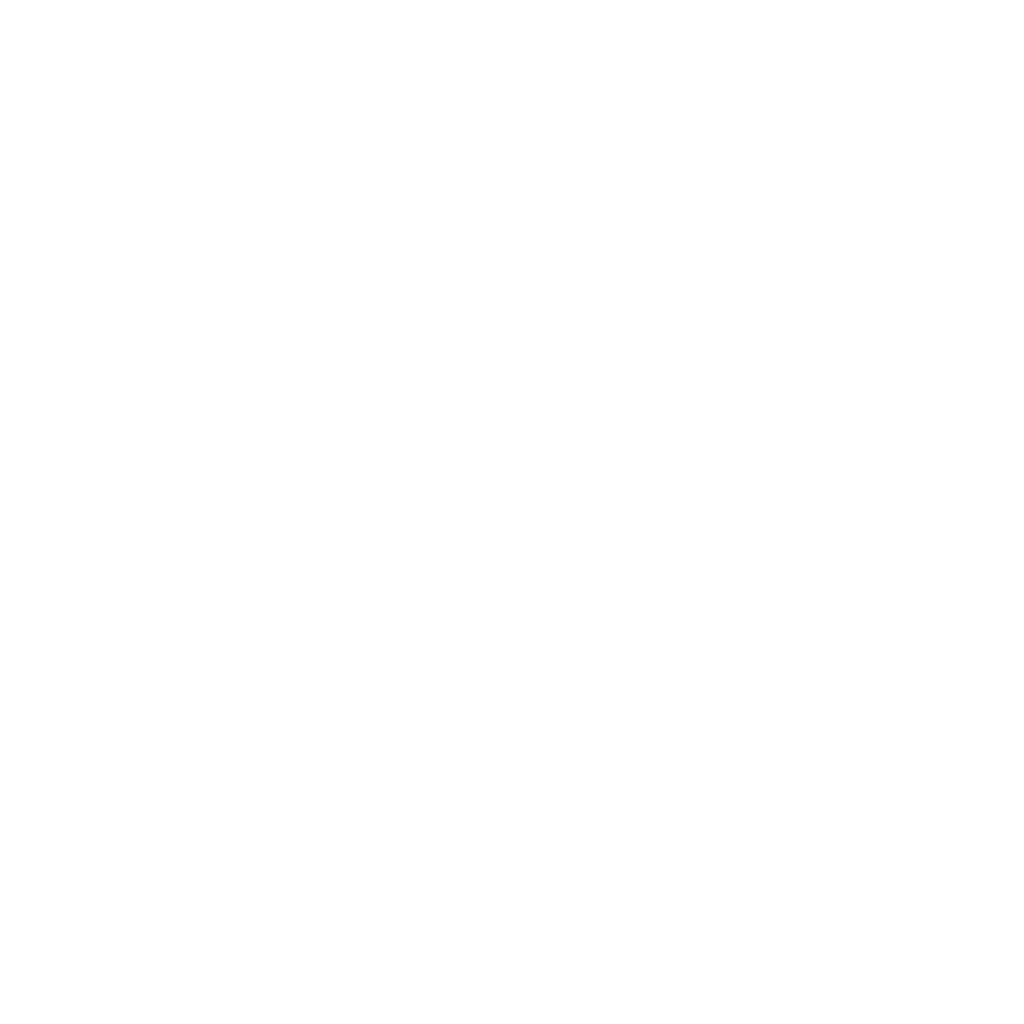
Psychologischer Kern: Im Kern steht eine Identität, die sich stark über Einzigartigkeit definiert.
Beförderer in der New Work Kultur: Sichtbarkeit als Währung: Algorithmische Aufmerksamkeit, Personal‑Branding, KPI‑Vergleiche (Follower, Sterne, OKRs)
Typische Selbstbotschaften: Die innere Stimme sagt: „Nur wenn ich heraussteche, bin ich etwas wert“.
So zeigt es sich im Alltag: Im Alltag zeigt sich das in polierten Showcases, ständigen Benchmarks, permanenten Scannen nach Resonanz und einem hohen Aufwand für Selbstdarstellung – oft mit Blick auf Follower, Sterne oder OKRs.
Grundgefühl: Leise Alarmbereitschaft, genährt von Mangel: kurze Anerkennungskicks mit anschließendem Crash; ein Pendeln zwischen heimlicher Scham und momentaner Großartigkeit.
Grundangst: Die Grundangst lautet, austauschbar oder unbedeutsam zu sein, nicht gesehen zu werden und im Mittelmaß zu verschwinden.
Ressourcen im gesunden Maß: Feines Resonanz-Radar, hohe soziale Wahrnehmung, Bühnen-/Storytelling-Stärke, Energie und Umsetzungsdrang, schnelle Lernschleifen, Netzwerkwillen und frühe Risiko-Antennen. Moderations- und Beziehungskompetenz, wirksame Kommunikation und sichtbare Umsetzungskraft.
Risiken bei Übersteuerung: Abhängigkeit von externer Bestätigung mit Impostor-Schleifen (Hochstapler-Syndrom), Overpromising und Redeanteilsdominanz, mentale Belastungen wie innere Leere, anhaltende Anspannung/Angst, Schlafstörungen, Reizüberflutung, Stimmungseinbrüche bis zu depressiven Verstimmungen und Burn-out.
Abgrenzung zum Sei perfekt Antreiber: Sei perfekt kippt in Fehlerintoleranz und Kontrollzwang; Sei besonders kippt in Differenz-/Show-Sucht (Applausökonomie, Overbranding).
Erlaubende Gegenbotschaft: „Beitrag vor Beifall – ich bin ok, auch wenn es still bleibt.“
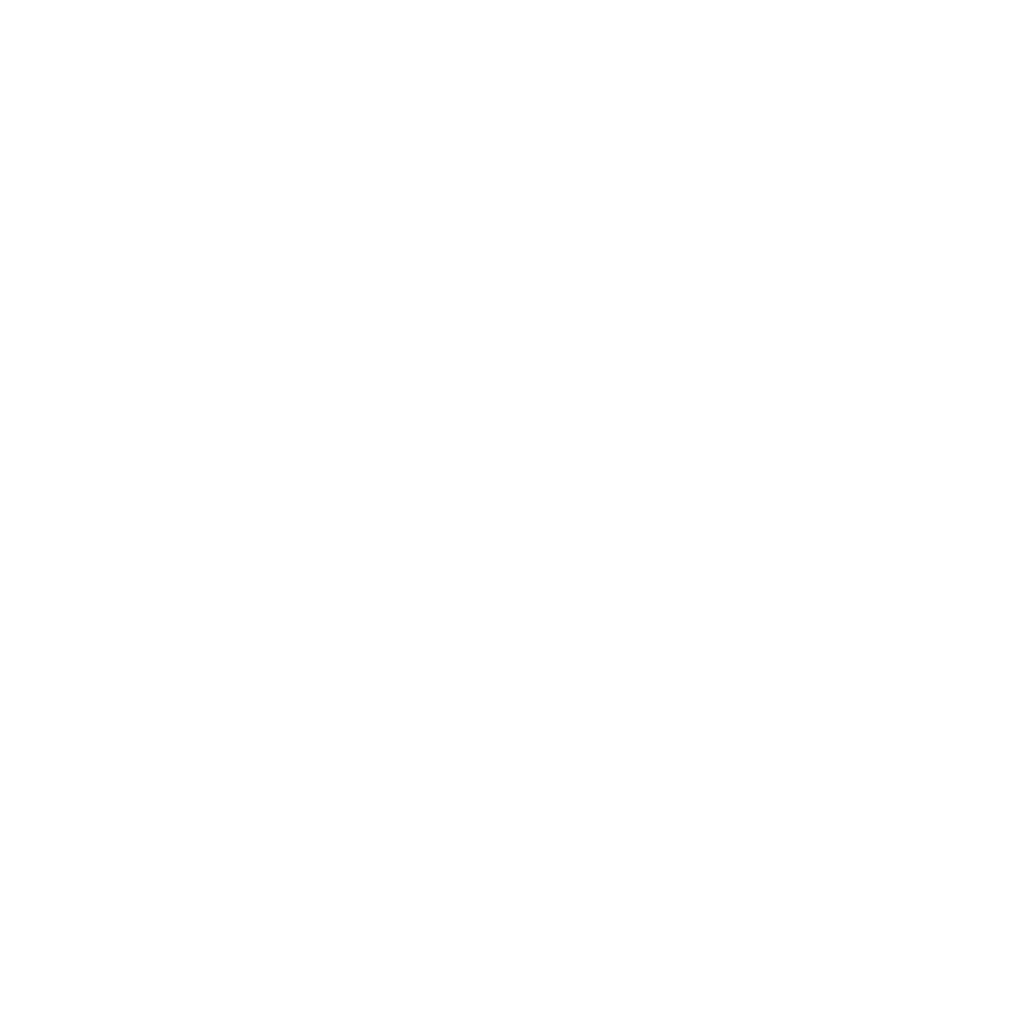
Psychologischer Kern: Im Kern steht eine Identität, die sich stark über Nützlichkeit und Leistung sowie innere Pflicht definiert.
Beförderer in der New-Work-Kultur: Effizienz als Währung: Automatisierung, Künstliche Intelligenz, Produktivitäts-Dashboards, OKRs/Lean/Kanban, „Inbox Zero“.
Typische Selbstbotschaften: Die innere Stimme sagt: „Ich muss mit wenig Aufwand viel Wirkung erzielen. Nur Messbares zählt.“
So zeigt es sich im Alltag: To-do-Taktung, Timeboxing, Multitasking, frühe Deadlines; standardisierte Prozesse + kontinuierliche Optimierung, KI für Routine/Entwürfe, Dashboards (Durchsatz, Lead Time, Fehlerquote).
Grundgefühl: Getriebene Anspannung auf Soll-Druck: kurzer Entlastungskick beim Abhaken, gefolgt von Leere/Crash; Pendeln zwischen Kontrollgefühl und Selbstvorwurf.
Grundangst: Nicht nur als langsam oder unnütz zu gelten, sondern ohne Effizienz innerlich an Wert zu verlieren; Pausen und Leerlauf erzeugen Schuldgefühle – Ineffizienz wird als Bedrohung erlebt.
Ressourcen im gesunden Maß: Klarheit, Zielorientierung und Priorisierung, Prozessdenken, Verlässlichkeit, Durchsatz und Rhythmus; Fähigkeit, Engpässe zu erkennen, Fluss herzustellen und konsequent auf Outcomes auszurichten.
Risiken bei Übersteuerung: Effizienz vor Effektivität – wir optimieren das Falsche; KPI-Gaming, Lokaloptimierung und Überstandardisierung ersticken Lernen, Beziehungen und Qualität. Chronische Anspannung und Schuldgefühle bei Leerlauf, Schlafstörungen/Stresssomatik bis Entscheidungsmüdigkeit und Burn-out.
Abgrenzung zum Sei schnell Antreiber: Sei schnell scheitert an Hastfehlern (Checks überspringen, sprunghaft); Sei effizient scheitert an Über-Systematisierung (falsche Dinge optimieren, Rigidität, KPI-Fetisch) – auch ohne hohes Tempo.
Erlaubende Gegenbotschaft: „Wirkung statt Dauer-Output: erst das Richtige, dann richtig – mit Puffer.“
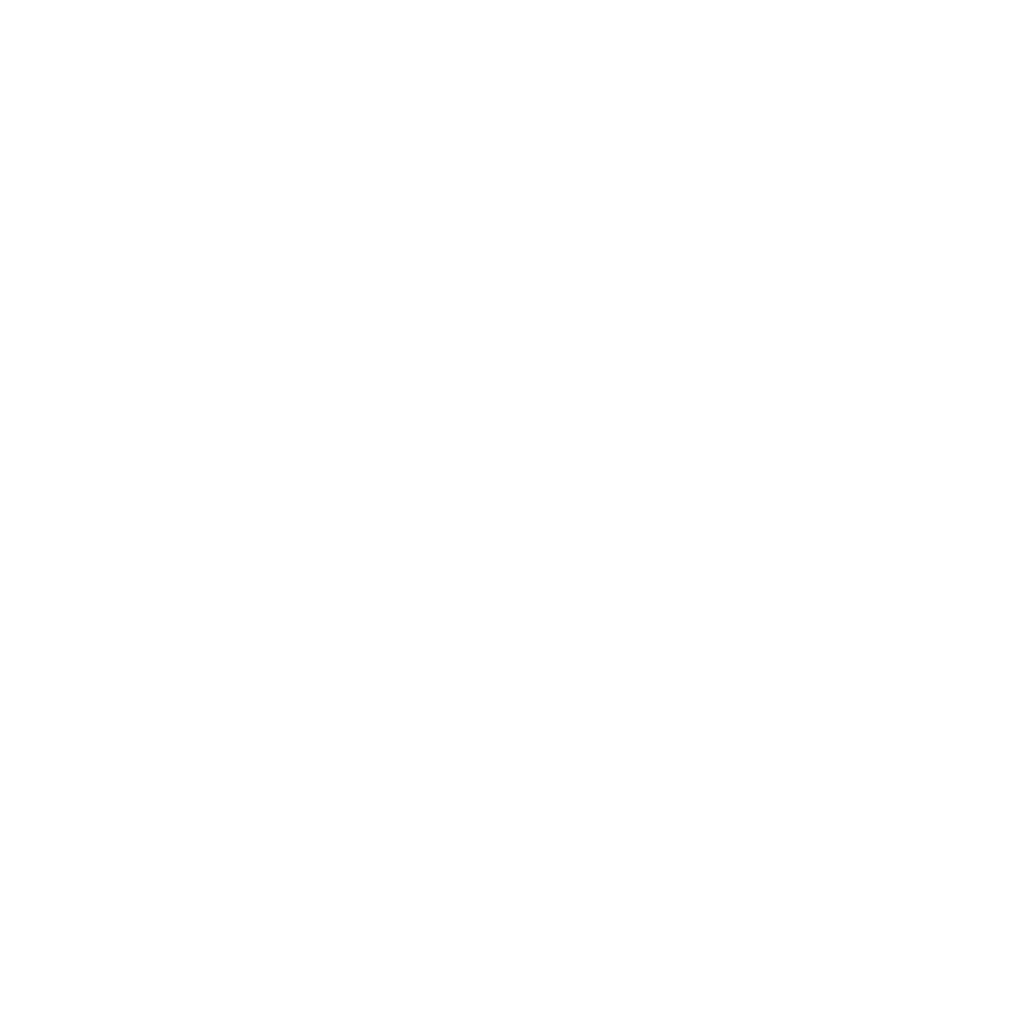
Psychologischer Kern: Die Identität ruht auf Wandlungsfähigkeit und einer inneren Pflicht, immer bereit zu sein.
Beförderer in der New-Work-Kultur: Veränderung als Währung: VUCA und BANI Narrative, Dauer-Change, Re-/Upskilling, Sprints/Backlogs, Beta-Kultur.
Typische Selbstbotschaften: „Wer stehen bleibt, verliert.“ „Ich muss immer lernbereit sein.“ „Was ich gestern konnte, zählt heute nichts mehr.“
So zeigt es sich im Alltag: Häufige Kursänderungen, Framework-Wechsel, viele Workshops/Retros, Backlog-Umsortierungen, Dauer-Pilotieren ohne Rollout, Work-Life-Blending durch ständige Erreichbarkeit.
Grundgefühl: Diffuse Unruhe und FOMO (Fear of missing out); kurzer Hochstart bei Neuem → Abflachen/Crash in Routine; Pendeln zwischen Aufbruchseuphorie und Erschöpfung, Drang nach neuen Reizen.
Grundangst: Irrelevant zu werden, als „veränderungsresistent“ zu gelten, den Anschluss zu verlieren. Schamangst bei Stillstand: Langeweile/Leerlauf konfrontiert mit Unsicherheit („Bin ich noch gut genug?“).
Ressourcen im gesunden Maß: Neugier, Experimentierradius, Lerngeschwindigkeit, Resilienz, Ambiguitätstoleranz, funktionsübergreifende Zusammenarbeit, Abschlussstärke, Wachstumsorientierung.
Risiken bei Übersteuerung: Change-Müdigkeit, Oberflächenarbeit, viele angefangene/kaum fertiggestellte Initiativen, Identitätsdiffusion und Angstzustände.
Abgrenzung zum Streng dich an Antreiber: Streng dich an vergöttert Einsatz (viel Mühe, wenig Wirkung); Sei agil vergöttert Wechsel (viele Kursänderungen, wenig Abschluss – Change-Müdigkeit).
Erlaubende Gegenbotschaft: „Stabilität ist erlaubt – ich darf fokussieren und Dinge zu Ende bringen; ich wähle Tiefe vor Wechsel“.
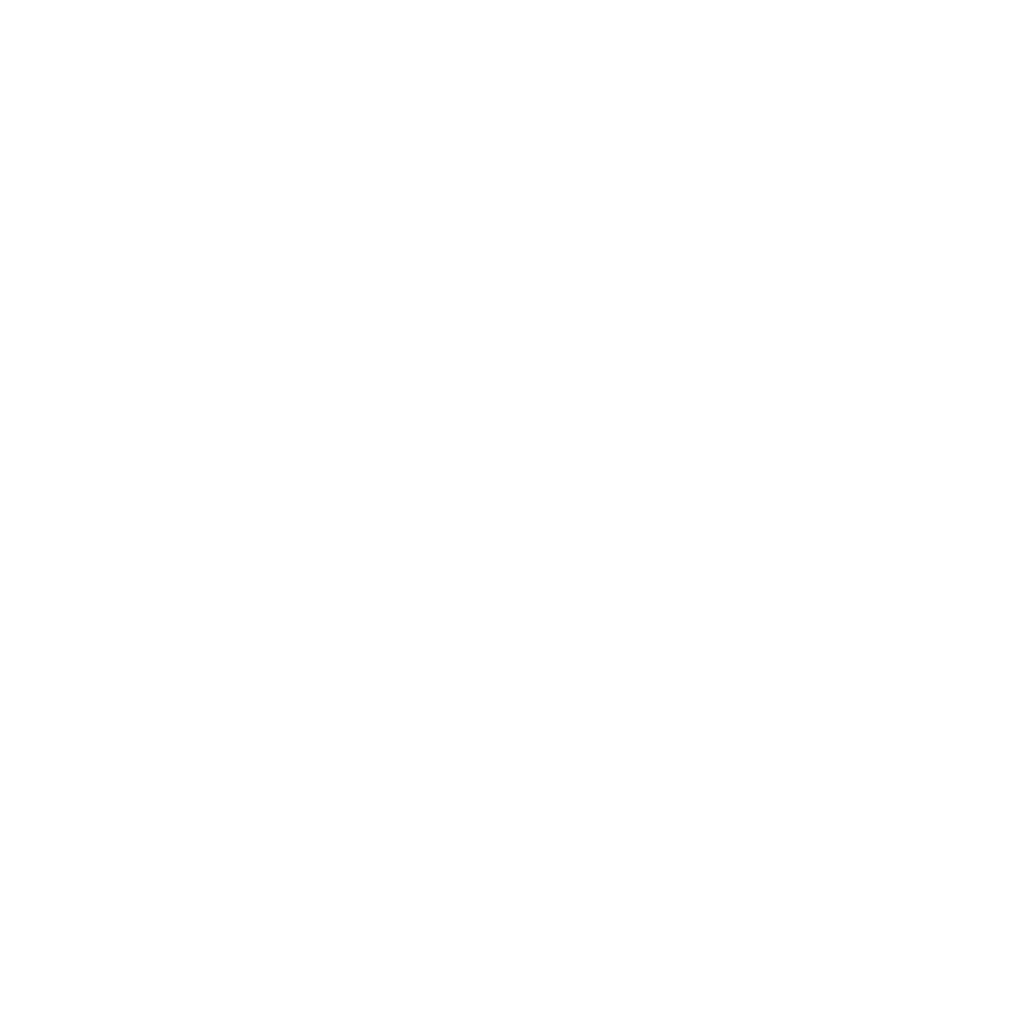
Psychologischer Kern: Die Identität gründet auf Aufhellung und Ermutigung; ein überhöhtes Positiv-Ideal wertet negatives Erleben ab.
Beförderer in der New-Work-Kultur: Positivität als Währung: Like-/Emojis-Kultur, Happiness-KPIs, Feel-Good-Management, Mindset-Slogans, Wellness-Programme.
Typische Selbstbotschaften: „Es muss mir gut gehen. Probleme ziehen runter – schnell umdeuten.“
So zeigt es sich im Alltag: Schnelles Schönreden, Pep-Talks (Ermutigungsansprachen), Konfliktmeidung, Emotions-Overlays, Dankbarkeits-Posts statt Risiko-Bearbeitung, Superlativsprache.
Grundgefühl: Aufgesetzte Leichtigkeit über innerer Anspannung; Lob entlastet kurz, Kritik fährt ein.
Grundangst: Primär die Angst vor Überflutung durch „Schwere“ („negative Gefühle“); nachgelagert die Furcht, dafür als „negativ“ abgelehnt zu werden.
Ressourcen im gesunden Maß: Zuversicht, Deeskalation, Motivationskraft, Begeisterungsfähigkeit, Fähigkeit, Sinn und Möglichkeiten zu markieren.
Risiken bei Übersteuerung: „Toxic Positivity“, Problemverdrängung, verspätetes Risikomanagement, emotionale Erschöpfung und Entfremdung, Daueranspannung, erhöhter Puls/Blutdruck, flache Atmung.
Abgrenzung zum Mach es allen recht Antreiber: Mach es allen recht verliert eigene Grenzen und meidet Konflikte; Sei positiv verdrängt Gefühle/Probleme.
Erlaubende Gegenbotschaft: „Echtheit vor Heiterkeit – ich darf alles fühlen und klar benennen.“
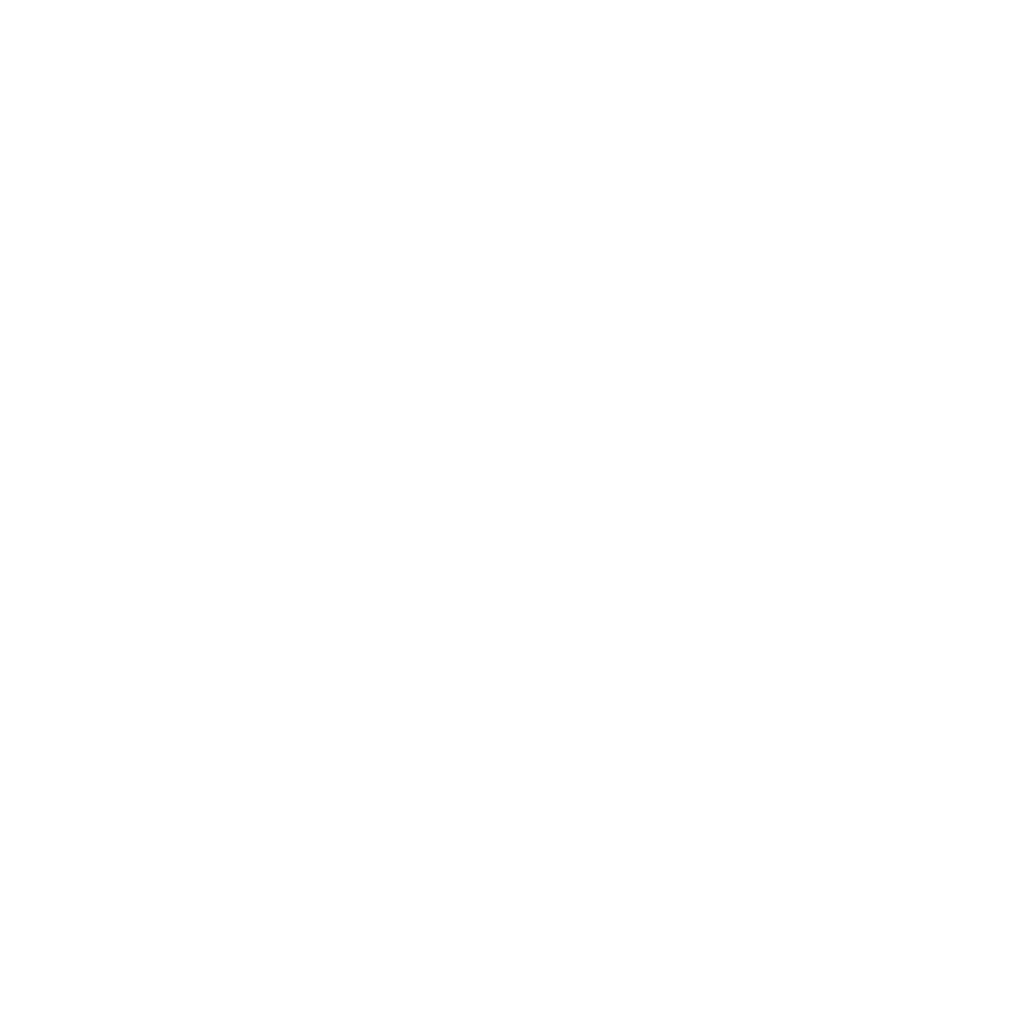
Psychologischer Kern: Identität über moralische Nützlichkeit und Wirkung; hoher Anspruch an Selbststimmigkeit.
Beförderer in der New-Work-Kultur: Sinn als Währung: Purpose-Branding, Impact-KPIs, North-Star-Metriken, Mission-Statements.
Typische Selbstbotschaften: „Ich muss einen sinnvollen Beitrag leisten, nur dann habe ich eine Berechtigung. „Ich darf nichts tun, das nicht trägt.“
So zeigt es sich im Alltag: Dauer-Purpose-Check & Selbstprüfung; Zusatzengagement; Abwertung von Routine/Admin; Moralisierung von Entscheidungen; Schuldgefühl bei Leerlauf/„Nichtstun“.
Grundgefühl: Ernste Getragenheit mit latenter Schuld; Hochgefühl bei sichtbarer Wirkung - Crash bei Ambivalenz/Widerspruch.
Grundangst: Bedeutungslosigkeit, Banalität, sinnlose Mühe, Entfremdung, moralisches Verfehlen/„falsches“ Handeln.
Ressourcen im gesunden Maß: Commitment, Einsatzbereitschaft, Ausdauer, Integrität, Langfristdenken, Gemeinschafts- und Orientierungsstiftung.
Risiken bei Übersteuerung: Über-Identifikation mit Mission, Intoleranz gegenüber Ambiguität, Selbstaufopferung/Burn-out, Urteilsrigidität, Handlungsblockaden bei Unklarheit, Bitterkeit und Zynismus.
Abgrenzung zum Sei stark Antreiber: Sei stark erstickt Bedürfnisse und trägt Überverantwortung; Sei sinnvoll verengt auf moralische Selbstüberforderung.
Erlaubende Gegenbotschaft: „Sinn wächst im Kleinen – ich tue den nächsten guten Schritt und sorge auch für mich“.
- Ein erster, behutsamer Zugang zur eigenen inneren Dynamik – zur Selbstreflexion, nicht zur Bewertung.
- Eine vertiefende Auseinandersetzung mit den inneren Antreibern unserer Arbeitswelt – lesend, nachdenklich, entlastend.
- Ein Raum für gemeinsames Verstehen und Erleben – jenseits von Selbstoptimierung, nah an der eigenen Wirklichkeit.
